Wer sich dieser Tage in Florenz, der zeitweiligen Hauptstadt des Königreichs Italien (1865-1871), umsah und auch einen Ausflug an die Adriaküste der Emilia-Romagna wagte, wird den Eindruck nicht los, dass die Tour-Stimmung weit entfernt ist von der „gelben Euphorie“, die vor zwölf Monaten nicht nur die „Grand départ“-Stadt Kopenhagen, sondern ganz Dänemark fest im Griff hatte.
Konkurrent EM
Was nicht ist, kann aber noch werden. Über einen Publikumsmangel braucht Florenz sich am Samstag bei den Startvorbereitungen der Tour keine Sorgen zu machen, denn die Stadt, die als Wiege der Kunstepoche Renaissance gilt, ist sowieso überflutet von Touristen aus aller Herren Länder, insbesondere aus den USA und Japan.
Wer es in der Bruthitze ohne Sonnenbrand durch die engen Gassen um die „Piazza del Duomo“ bis zum „Palazzo Vecchio“ schafft, der darf sich glücklich schätzen. Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis auch Florenz dem Beispiel Venedigs folgend vom Tagesbesucher Geld für den Eintritt in den Stadtkern verlangt.
Am Abend, im Zielort Rimini, wird es genügend Platz für die Zuschauer geben, doch auf der 850 m langen Zielgeraden am Strand ist weit und breit kein Strauch auszumachen. Dort riskiert man, ohne Kopfbedeckung in der knallenden Sonne schnell ein Fall für den „Pronto Soccorso Ambulanza“ zu werden.
Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass viele Einheimischen und Touristen sich in der Bruthitze lieber auf einer der unzähligen Terrassen vor die hochauflösenden, überdimensionierten Fernsehschirme verkriechen. Dies um so mehr, da die Tour-Ankunft (17.45 Uhr) kurz vor dem Anpfiff des EM-Achtelfinales Italien – Schweiz (18.00 Uhr) programmiert ist.
Tour nur zweite Wahl
Wie wichtig der Fußball für die Italiener ist, sieht man am besten am Beispiel der auf lachsfarbenem Papier gedruckten Sportzeitung La Gazzetta dello Sport. Am Donnerstag und am Freitag war das Blatt jeweils 48 Seiten stark, davon waren am Donnerstag 36,5 und am Freitag 33 dem Fußball gewidmet. Für die Tour de France hatte die Chefredaktion dagegen nur zweieinhalb (Donnerstag) bzw. zwei Seiten (Freitag) Platz.
Die Gazzetta, die so wunderbar aufgemacht ist und so großartig nach Farbe riecht, ist eine meiner Lieblingszeitungen. Leider ist sie seit Jahren nicht mehr in Luxemburg zu bekommen. Als auflagenstärkste der drei Sport-Tageszeitungen Italiens (127.776 Exemplare am 28.6.2024) konnte sie im Laufe der Jahre die Konkurrenten Corriere dello Sport – Stadio und Tuttosport problemlos auf Distanz halten. Eigentlich ist es ein Wunder – und in Europa einzigartig –, dass in einem Land von knapp 60 Millionen Einwohnern drei Sport-Tageszeitungen nebeneinander bestehen können.
450 m bis zum Todeshotel
Im Februar 2024, anlässlich des 20. Todestags von Marco Pantani, brachte die Gazzetta drei Sondernachdrucke auf den Markt, die sich mit dem „Piraten“ befassen. Die Nummern 1 und 2 behandeln die „Soli“ des Ausnahmefahrers im Giro und in der Tour de France, Nachdruck Nr. 3 (Ausgabe vom 15.2.2004) dagegen berichtet über den mysteriösen Tod Pantanis tags zuvor in einem Hotel in Rimini.
Das „Le Rose Suite Hotel“ in der Viale Regina Elena 46, in dem das Drama stattfand, liegt nur 450 m oder sechs Gehminuten nördlich von der Stelle, wo heute Abend die Ankunft der ersten Etappe vorgesehen ist.
Nach dem Umbau des Hotels aber gibt es das Zimmer D5, in dem Pantani starb, nicht mehr. Am 14. Februar 2004 („Giorno di San Valentino“) glich es einer Rumpelkammer. Als Pantani gegen 21 Uhr tot aufgefunden wurde, war die Unterkunft verwüstet. Hilferufe des „Piraten“, der sich bedroht fühlte und am Morgen die Rezeption telefonisch gebeten hatte, die Carabinieri zu holen, waren auf taube Ohren gestoßen.
Das Rätsel bleibt
Fakt ist, dass der Giro- und Tour-de-France-Sieger von 1998 an einem Herzinfarkt starb, hervorgerufen durch eine Überdosis Kokain. Weil es für die Ermittler keine Zweifel an einem „unfreiwilligen Selbstmord“ gab, wurden andere Spuren ignoriert. Im Körper Pantanis (Bauchspeicheldrüse, Galle) wurde sechsmal mehr Rauschgift gefunden als für den Tod notwendig gewesen wäre. Zwang jemand Pantani, das Kokain zu schlucken?
Pantanis Mutter Tonina und sein Vater Paolo sind auch heute noch fest davon überzeugt, dass ihr Sohn keine Selbstmordgedanken hatte. Pantani, der 1999 den Giro d’Italia in Madonna di Campiglio wegen überhöhten Hämatokritwerts verlassen musste, war wiederholt mit verbotenen Substanzen in Kontakt gekommen.
Obwohl er die durch die Festina-Affäre „verseuchte“ Tour 1998 im strömenden Regen durch einen heroischen Ritt über den Galibier rettete und auch im Jahr 2000 nochmals zwei Etappen (Mont Ventoux und Courchevel) gewann, waren er und sein Team danach nicht mehr bei der Tour erwünscht. Pantani wurde depressiv und war ein gefundenes Fressen für die Drogenbeschaffer.
Verbotene Liebe
Dem „Piraten“ zu Ehren startet die zweite Etappe morgen Sonntag in seinem Heimatdorf Cesenatico 24 km nördlich von Rimini. Heute Samstag wird der Tour-Sieger Gino Bartali (1938, 1948) und Gastone Nencini (1960) gedacht, am Montag ist die Reihe an Fausto Coppi (1949, 1952), ehe am Dienstag auf dem Weg von Pinerolo nach Valloire noch einmal Coppi und Pantani zu Ehren kommen.
Fausto Coppi und Gino Bartali bleiben auf ewig die Aushängeschilder des italienischen Radsports. An beiden Namen scheiden sich auf der Halbinsel auch heute noch die Geister, und das nicht nur wegen ihrer Erfolge auf den Landstraßen Europas.
Bartali war streng gläubig, Coppi dagegen verstieß gegen alle Regeln, die in den Fünfzigerjahren im puritanischen Italien herrschten. Er, der mit seiner Jugendliebe Bruna verheiratet war, hatte in Giulia Occhini, der Frau des Arztes Enrico Locatelli, eine Bewunderin, die ihm von Rennen zu Rennen nachreiste. Es dauerte nicht lange, bis der Doktor seine Gattin des Ehebruchs anklagte und diese sogar in die Arrestzelle musste. Der Vatikan mischte sich ein, der Papst verweigerte den Giro-Fahrern seinen Segen. Eine Scheidung wie in anderen Ländern war damals in Italien laut Gesetz nicht möglich.
Der Fromme
Offiziell tauchte Giulia Occhini, die wegen ihres weißen Mantels fortan die „Dama Bianca“ („Dame in Weiß“) genannt wurde, am 30. August 1953 erstmals an der Seite Coppis auf, als sie bei der WM-Siegerzeremonie in Lugano mit aufs Podium durfte. Als Coppi sich Ende 1959 bei einer Jagd in Obervolta mit dem Malaria-Virus infizierte und dieser zu spät erkannt wurde, musste Giulia dem Pfarrer, der die Sterbesakramente verweigern wollte, versprechen, ihren Geliebten, mit dem sie jahrelang zusammengelebt und ihren Sohn Faustino gezeugt hatte, zu verlassen, wenn er jemals wieder gesund werden sollte.
Bartalis Privatleben dagegen verlief ganz anders. Er war mit Adriana (1919-2014) verheiratet, die ihm drei Söhne schenkte (Andrea, Luigi, Biancamaria). Die Beziehung war perfekt, die Ehe glücklich. Bartali war Kirchengänger, man nannte ihn den „Frommen“ („il Pio“) oder den „radelnden Mönch“.
Gerechter unter den Völkern
Über einen Teil seines Privaten sprach Bartali nie, es hätte ihn sein Leben kosten können. Im Krieg hatte der Erzbischof von Florenz, Elia Dalla Costa, ein antifaschistisches Netzwerk gegründet. Es galt, Juden zu retten und außer Landes zu bringen. Dazu aber bedurfte es gefälschter Dokumente, die den Juden eine neue Identität verschaffen sollten. Die Druckpresse stand in Assisi, die Papiere mussten dorthin gebracht werden.
Der Kurier hieß Bartali! Immer wieder fuhr er durch die Abruzzen, die Toskana und Umbrien, versteckte die Dokumente im Sattelrohr seines Rennrades und gab sie an der Klostertür in Assisi ab. Rund 800 Juden sind auf diese Weise vor der Verschleppung in die Konzentrationslager gerettet worden.
Gino Bartali wurde im Jahr 2013 an der Gedenkstätte der Shoah, Yad Vashem, der Titel „Gerechter unter den Völkern“ verliehen, ein Ehrentitel für nichtjüdische Personen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben einsetzten, um Juden vor der Ermordung zu retten.


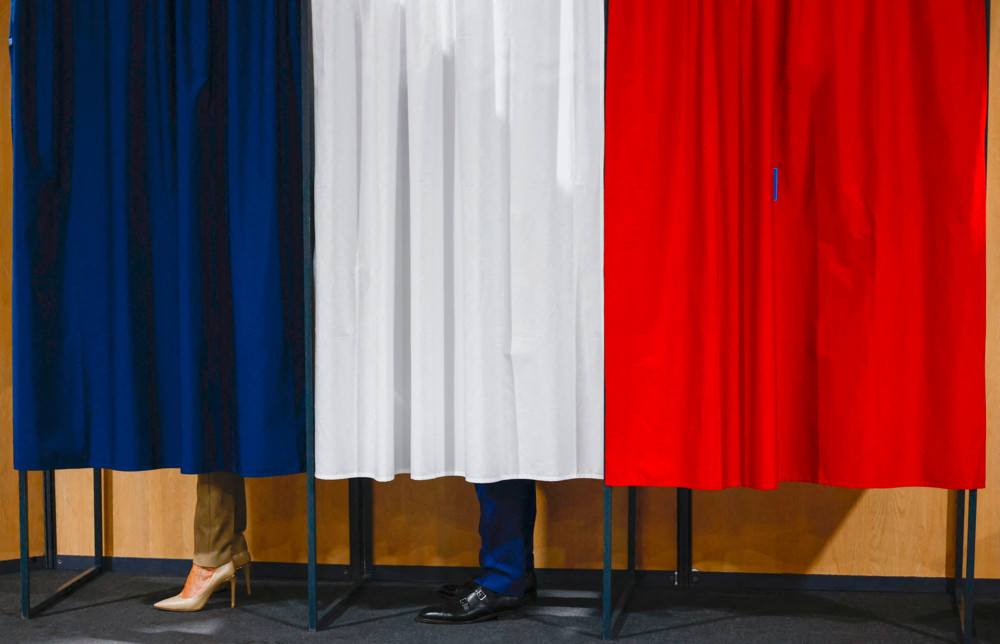


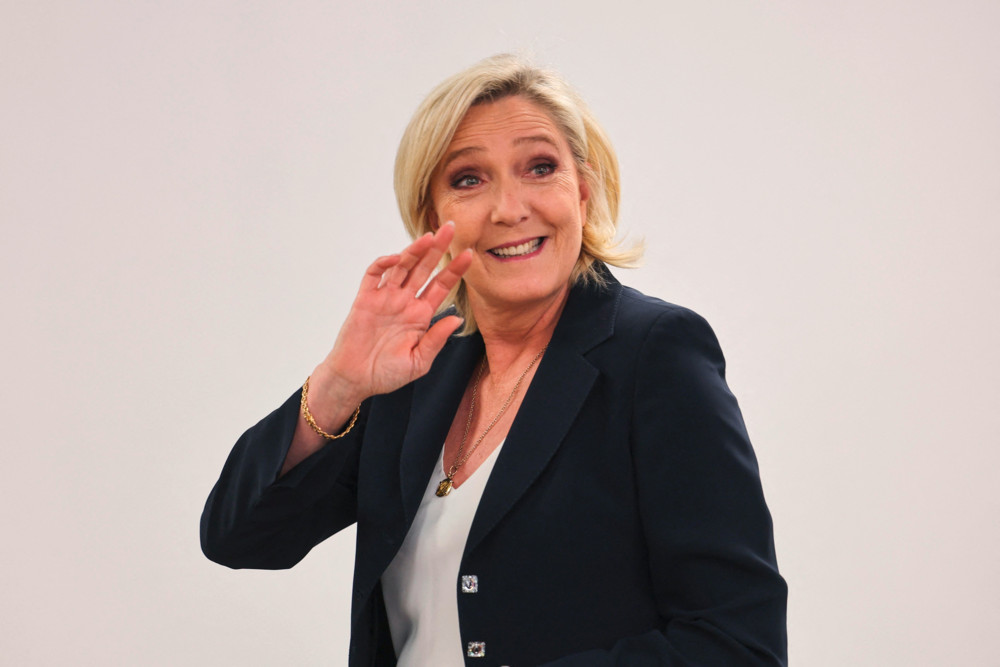


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können