Das Jahr 2022 bot eine Reihe von Gelegenheiten, um Josy Barthel zu gedenken. Der 1.500-m-Olympiasieger wurde am 24. April 1927, also vor 95 Jahren, geboren und starb am 7. Juli 1992, demnach vor 30 Jahren. Er übernahm im Jahr 1962 (vor 60 Jahren) die Geschicke seines so geliebten Leichtathletikverbandes und führte ihn dank einiger kühner Reformen innerhalb von zehn Jahren aus dem Schlamassel.
Als Prosper Link, der 1970 die Nachfolge von Paul Wilwertz als Präsident des „Comité olympique et sportif luxembourgeois“ (COSL) antrat, rund einen Monat vor den Spielen von München 1972 (vor 50 Jahren) einer Herzattacke erlag, wurde der Ruf nach Josy Barthel, diesem äußerst bescheidenen, ehrgeizigen und fleißigen Mann laut, sich für den Posten zu bewerben. Gedacht, gesagt, getan. Bis zu seiner Ministerberufung am 16. September 1977 (vor 45 Jahren) blieb Barthel an der Spitze der Dachorganisation des Luxemburger Sports.
Im Regen von London
Mit 21 Jahren bestritt Josy Barthel am 6. August 1948 im Wembley-Stadion sein erstes olympisches 1.500-m-Finale. Zu diesem Zeitpunkt hatte er in London bereits drei Rennen hinter sich. Am 30. Juli zog er über die 800-m-Distanz im dritten Vorlauf in 1’54“8 in das Halbfinale ein, schaffte es am Tag danach (31.7.) aber nicht in den Endlauf und schied als 6. in 1’54“6 aus.
Das Finale über 1.500 m erreichte Barthel am 4. August als Dritter des dritten Vorlaufs mit der Zeit von 3‘56“4. Der Endlauf fand zwei Tage später bei Regen und relativ kaltem Wetter statt. Er war anfangs geprägt vom Franzosen Marcel Hansenne, der zuvor Bronze über 800 m gewonnen hatte, auf der längeren Mittelstrecke aber Opfer seines eigenen Tempos wurde und sich mit dem 11. Rang begnügen musste.
Eine Bemerkung am Rande: Marcel Hansenne, der nach seiner Sportlerkarriere Journalist und Chefredakteur bei der französischen Fachzeitschrift L’Equipe wurde, trainierte nach dem Intervallprinzip des Deutschen Woldemar Gerschler, der in den 1930er Jahren den Ausnahmesportler Rudolf Harbig entdeckt und ihn zum mehrfachen 800-m-Weltrekord geführt hatte.
Von 9 auf 10
Auch Barthel verdankte sein Olympiagold von 1952 dem deutschen Trainer, der hauptberuflich Direktor des Instituts für Leibeserziehungen der Albert-Ludwigs-Universität von Freiburg war.
Der Luxemburger hielt dies übrigens in einem handschriftlichen Brief vom 26. Oktober 1952 an die Deutsche Olympische Gesellschaft fest: „Mein olympischer Sieg in Helsinki war ein Sieg der Kameradschaft mit meinem deutschen Trainer Woldemar Gerschler. Er ist für mich der Mann, der über nationale Interessen hinweg durch seine Haltung der olympischen Idee einen echten Dienst erwiesen hat. In diesem Geist siegte ich in Helsinki, und so möchte ich meinen Erfolg verstanden wissen.“
Doch zurück nach London 1948: Auf die beiden obersten Treppchen stiegen zwei Schweden, wobei Henry Eriksson (3‘49“8) seinen favorisierten Landsmann und Mitinhaber des Weltrekords Lennart Strand (3‘50“4) etwas überraschend besiegte.
Über das Klassement von Platz 7 bis 12 sind sich viele Fachleute auch heute noch nicht einig. So wird Josy Barthel in den meisten Publikationen (sogar offiziellen) auf Rang 9 geführt, doch dokumentiert der Film des Rennens eindeutig, dass der Amerikaner Don Gehrmann als Achter und nicht, wie in vielen Klassementen vermerkt, als Zehnter einlief. Barthel rückt also einen Platz nach hinten, von Rang 9 auf 10. Seine Zeit: 3‘56“9.
Josy „Bartell“
Vier Jahre später in Helsinki schaffte Josy Barthel es nicht nur zum zweiten Mal in einen Endlauf über 1.500 m, sondern er gewann das Rennen und holte offiziell die erste olympische Goldmedaille für sein Land. Bei diesen Spielen war Barthel nur über die längere Mittelstreckendistanz eingeschrieben. Er blieb unbesiegt. Am 24. Juli gewann er den ersten von sechs Vorläufen über 1.500 m in handgestoppten 3‘51“6 und tags darauf das zweite Halbfinale in 3‘50“4.
Knappe 23 Stunden später folgte der große Coup. Ich erinnere mich an diesen 26. Juli 1952. Es ist Samstag, 16.30 Uhr, ganz Luxemburg hat das Ohr am Rundfunkempfänger. Fernsehen ist noch Zukunftsmusik. Der Vater Ihres Kolumnisten fummelt im „Café de la Place“ in Niederkorn (heute „Café Progrès“) am Radioknopf. Die Franzosen wissen viel von ihrem Star Patrick El Mabrouck zu erzählen, bei den Deutschen geht andauernd und heftig die Rede vom langen Werner Lueg. Den Josy „Bartell“, wie der deutsche Radioreporter unseren Landmann nennt, haben die wenigsten auf der Rechnung.
Der schmächtige Mittelstreckenathlet aus dem kleinen Großherzogtum aber läuft die Konkurrenz in Grund und Boden und wehrt auf den letzten Metern den Ansturm des Amerikaners Robert McMillen ab: 3’45“2, neuer olympischer Rekord! Erbgroßherzog Jean hängt dem Sieger die Goldmedaille um den Hals. Barthel kann seine Tränen beim Abspielen der „Hémecht“ nicht verbergen. Im ganzen Land bricht unbeschreiblicher Jubel aus, in Niederkorn tanzen sie auf der Straße.
Léon Letsch und Jean Hamilius
Die Spiele von Helsinki 1952 waren die erfolgreichsten in der Geschichte des Luxemburger Sports. Neben Josy Barthels Olympiasieg ragten auch andere Leistungen weit über den Durchschnitt hinaus. So bezwangen die Fußballer England mit 5:3 nach Verlängerungen und verloren nur 1:2 gegen Brasilien. In beiden Spielen stürmte Léon Letsch, der Schwiegersohn des doppelten Tour-de-France-Gewinners Nic Frantz (1927, 1928), auf links. Der heute 95-Jährige, der sich zur Vernissage der 3.45.2-Ausstellung angemeldet hat, schoss gegen England in den Verlängerungen die Tore zum 2:1 (91‘) und 4:1 (98‘).
Die Fechter verpassten die Medaillenränge zweimal ganz knapp. Im Degeneinzel stieß Léon Buck bis ins Finale vor und kam trotz 6 Siegen nur auf den undankbaren 4. Platz. Denselben Rang belegte das Team Léon Buck, Fernand Leischen, Bub Gretsch, Paul Anen im Mannschaftswettbewerb.
In die Sportgeschichte ein ging auch die Zeit, die Robert Schaeffer, Jean Hamilius, Fred Hammer und Gérard Rasquin über 4×400 m erzielten. Die 3‘16“2 verschwanden erst 46 Jahre später aus den Rekordlisten, als Paul Zens, Claude Godart, Marc Reuter und Carlos Calvo in Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens, 3‘15“58 liefen. Als Einziger der Staffel von Helsinki 1952 ist der 95-jährige Jean Hamilius noch am Leben. Genau wie Léon Letsch will er heute Abend bei den Feierlichkeiten zu Ehren seines früheren Leichtathletik- und Ministerkollegen dabei sein.
Ein weiter Weg
Zwischen Josy Barthels 25. Lebensjahr mit den olympischen Lorbeeren und dem 50. mit der Berufung zum Minister lag neben dem sportlichen auch ein beruflich ausgefülltes Vierteljahrhundert. Barthel, der 1951 als Diplomchemiker im Staatslaboratorium anfing, ging ein Jahr nach seinem Olympiasieg in die USA, um sich an der wohl renommiertesten Hochschule der Welt, der Harvard University, weiterzubilden.
Wer ihn besser kannte, dem gestand Josy Barthel auch schon mal ein, ab und zu Angst vor sich selbst zu haben. „Ich bin ein Draufgänger, dem es nie schnell genug geht. Aber trotzdem glaube ich, dass ich ein umgänglicher Mensch bin, der den Kontakt mit den anderen sucht und auf sie hört. Das eine schließt das andere nicht aus. Man kann zielstrebig, hartnäckig und zugleich kompromissbereit sein.“
Für Josy Barthel selbst war im Jahr 1977 die Bestellung zum Minister für Umwelt, Energie, Tourismus und Transport die vierte große Herausforderung in seinem Leben. Sozusagen das vierte „Rennen“, das er bestritt und wie die anderen auch gewinnen wollte.
Vier „Rennen“
Das erste war der 1.500-m-Lauf bei den Olympischen Spielen von Helsinki 1952, das zweite die in den 1970er Jahren geglückte Säuberung vieler einheimischer Gewässer (u.a. der Alzette) und das dritte die mit Erfolg abgeschlossene Sportdirigentenlaufbahn.
Nach dem Ende der blau-roten Koalition (1979) unter Regierungschef Gaston Thorn, blieb Barthel auch Minister im nachfolgenden Kabinett Werner-Flesch (1979-1984). Als die DP danach auf Landesebene in die Opposition gedrängt wurde, setzte er sein politisches Mandat als Deputierter fort. Gleichzeitig war er Mitglied im hauptstädtischen Gemeinderat.
Sechs Wochen nach der Vorstellung des Buchs „Josy Barthel, la fameuse histoire d’une consécration olympique“ starb Josy Barthel am 7. Juli 1992 an der Krankheit, die er glaubte, mit seiner außergewöhnlichen Willenskraft besiegen zu können. 19 Tage später feierte Luxemburg den 40. Jahrestag des Triumphes von Helsinki.







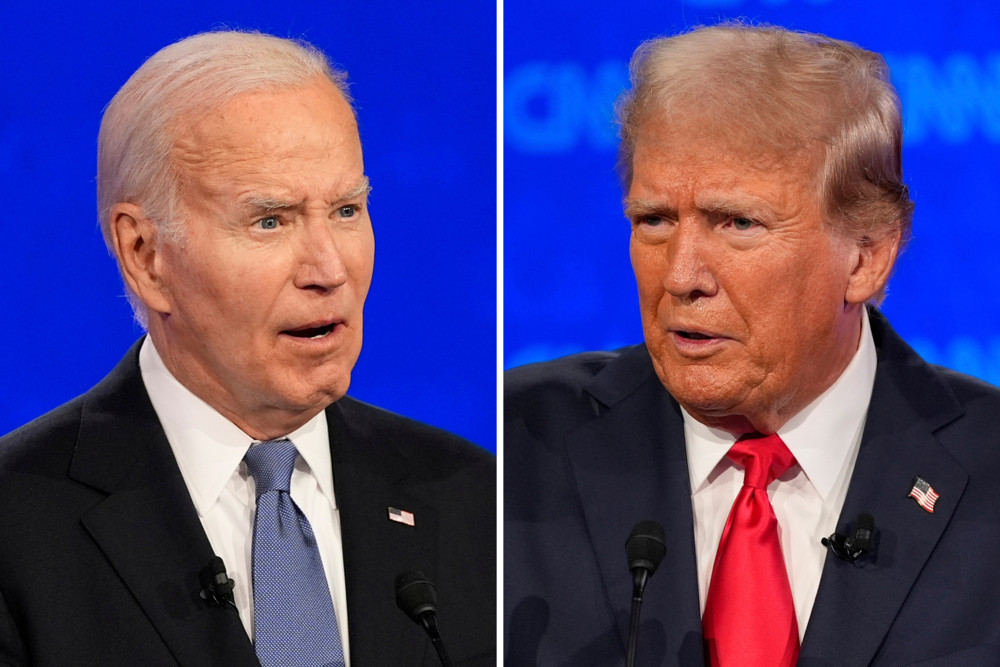
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können